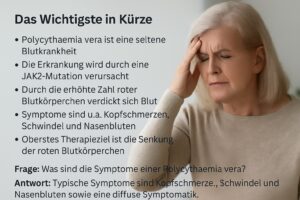Polycythaemia vera: Symptome & Hilfe
Polycythaemia vera ist eine seltene Bluterkrankung, die meist erst spät erkannt wird – oft erst bei schwerwiegenden Komplikationen. Besonders ältere Menschen sind betroffen, wobei erste Symptome wie Müdigkeit, Schwindel oder Juckreiz häufig unterschätzt werden. Ursache ist meist eine genetische Mutation im JAK2-Gen, die zu einer Überproduktion von Blutzellen führt. Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, um Risiken wie Thrombosen oder Schlaganfälle zu vermeiden. Die Behandlung kann zwar keine Heilung bringen, aber durch Aderlässe, Medikamente und engmaschige Kontrollen die Lebensqualität erheblich verbessern.
Inhaltsverzeichnis
Das Wichtigste in Kürze:
- Sehr seltene Erkrankung: Nur etwa 0,7 von 100.000 Menschen pro Jahr betroffen
- Vor allem ältere Erwachsene: Häufige Diagnose nach dem 60. Lebensjahr
- Ursache ist fast immer eine JAK2-Mutation: Führt zu übermäßiger Blutbildung
- Unspezifische Symptome erschweren Früherkennung: Müdigkeit, Juckreiz, Kopfschmerzen
- Frühe Diagnose schützt vor Komplikationen: Thrombosen, Infektionen, Milzvergrößerung
Häufigkeit und Altersverteilung
Polycythaemia vera ist eine sehr seltene Bluterkrankung. In Mitteleuropa erkranken jährlich nur etwa 0,7 von 100.000 Menschen daran. Besonders häufig tritt sie bei älteren Erwachsenen auf. Die Mehrheit der Betroffenen ist bei Diagnosestellung über 60 Jahre alt. Dies liegt vor allem daran, dass die Symptome oft unspezifisch und schleichend sind. Viele Patientinnen und Patienten deuten frühe Beschwerden nicht richtig. Erst wenn ernstere Komplikationen auftreten, wird die Erkrankung erkannt. Die Seltenheit erschwert zudem eine frühe Diagnose. Hausärztinnen und Hausärzte müssen bei Symptomen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Schwindel auch an seltene Ursachen denken. Frauen und Männer sind etwa gleich häufig betroffen. Eine familiäre Häufung kann vorkommen, ist aber selten. Oft wird Polycythaemia vera zufällig im Rahmen einer Blutuntersuchung entdeckt. Die genaue Beobachtung von Blutwerten bei älteren Menschen spielt daher eine entscheidende Rolle.
Ursachen der Polycythaemia vera
der Polycythaemia vera
Die Ursache der Erkrankung liegt meist in einer genetischen Mutation. In über 95 % der Fälle ist das sogenannte JAK2-Gen verändert. Dieses Gen steuert die Produktion eines Eiweißes, das für die Blutbildung zuständig ist. Wenn es mutiert ist, kommt es zu einer Fehlregulation der Blutbildung. Die Folge ist eine übermäßige Produktion von Blutzellen, vor allem von roten Blutkörperchen. Dadurch wird das Blut dickflüssiger. Die Erkrankung zählt zu den sogenannten myeloproliferativen Neoplasien. Diese Erkrankungsgruppe betrifft das Knochenmark und die Bildung der Blutzellen. Eine Vererbung ist zwar möglich, aber selten. Meist tritt die Mutation spontan im Laufe des Lebens auf. Warum es zur JAK2-Mutation kommt, ist bislang nicht abschließend geklärt. Umweltfaktoren oder andere genetische Einflüsse könnten eine Rolle spielen. Forschungen hierzu laufen noch. Klar ist: Die JAK2-Mutation gilt als wichtigster diagnostischer Marker der Erkrankung.
Symptome und Beschwerden
Die Symptome der Polycythaemia vera sind oft unspezifisch. Zu Beginn fühlen sich viele Patient:innen lediglich abgeschlagen oder müde. Besonders häufig klagen Betroffene über Kopfschmerzen, Schwindel und Ohrensausen. Auch Nasenbluten tritt häufig auf. Weitere Beschwerden können Juckreiz, vor allem nach dem Duschen, oder ein Kribbeln in den Gliedmaßen sein. Diese Symptome entstehen durch die schlechte Durchblutung infolge der Blutverdickung. Die erhöhte Zahl roter Blutkörperchen führt dazu, dass das Blut langsamer fließt und Gefäße verstopfen können. Manchmal kommt es auch zu Sehstörungen, Nachtschweiß oder Knochenschmerzen. Die Symptome sind oft diffus und schwer einzuordnen. Daher wird die Krankheit häufig erst spät erkannt.
| Typische Symptome der Polycythaemia vera |
|---|
| Kopfschmerzen |
| Schwindel |
| Nasenbluten |
| Ohrensausen |
| Juckreiz nach Wasserkontakt |
| Kribbeln in Händen oder Füßen |
| Müdigkeit |
| Nachtschweiß |
| Knochenschmerzen |
Krankheitsverlauf und mögliche Komplikationen
Wird Polycythaemia vera nicht behandelt, kann sie zu gefährlichen Komplikationen führen. Die zähe Konsistenz des Blutes erhöht das Risiko für Gefäßverstopfungen. Thrombosen, Lungenembolien oder Schlaganfälle sind mögliche Folgen. Auch ein Herzinfarkt kann durch die eingeschränkte Durchblutung entstehen. Im weiteren Verlauf kann sich die Krankheit verändern. Die Produktion der Blutzellen nimmt dann ab. Das Immunsystem wird geschwächt. Die Folge ist eine erhöhte Infektanfälligkeit. In manchen Fällen vergrößert sich auch die Milz krankhaft. Diese sogenannte Splenomegalie verursacht ein Druckgefühl im Oberbauch. Dank moderner Therapien lassen sich viele dieser Entwicklungen heute vermeiden. Voraussetzung ist eine frühzeitige Diagnose und konsequente Behandlung. Wichtig ist auch die regelmäßige Kontrolle der Blutwerte. So lassen sich Veränderungen rechtzeitig erkennen. Ein stabiler Verlauf ist bei guter Betreuung durchaus möglich.
Diagnoseverfahren bei Verdacht auf Polycythaemia vera
Die Diagnose beginnt meist mit einer Blutuntersuchung. Auffällig ist dabei eine deutlich erhöhte Anzahl roter Blutkörperchen. Auch der Hämatokritwert – also der Anteil der Zellen am Blutvolumen – ist erhöht. Besteht ein Verdacht auf Polycythaemia vera, folgt der Nachweis der JAK2-Mutation. Dies geschieht durch eine molekulargenetische Untersuchung. Zur Sicherung der Diagnose wird in vielen Fällen zusätzlich eine Knochenmarkbiopsie durchgeführt. Dabei wird Gewebe aus dem Beckenkamm entnommen und im Labor untersucht. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die sogenannte Erythropoetin-Konzentration im Blut. Dieser Wert ist bei Polycythaemia vera in der Regel erniedrigt. Ergänzend erfolgt meist eine Ultraschalluntersuchung der Milz. Denn bei vielen Patient:innen ist sie vergrößert. Die Diagnosestellung erfolgt immer durch eine Fachärztin oder einen Facharzt für Hämatologie. Die enge Zusammenarbeit mit Hausärzt:innen bleibt aber wichtig.
Behandlungsmöglichkeiten und Therapieziel
Die Polycythaemia vera ist zwar nicht heilbar, aber gut behandelbar. Das Ziel der Therapie ist es, die Anzahl der roten Blutkörperchen zu senken und Komplikationen zu vermeiden. Die erste Maßnahme ist meist der Aderlass. Dabei wird regelmäßig Blut entnommen, um den Hämatokrit zu senken. Ergänzend werden Thrombozytenaggregationshemmer verabreicht. Diese Medikamente verlangsamen die Blutgerinnung und beugen Blutgerinnseln vor. Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, kommen zytoreduktive Medikamente zum Einsatz. Diese sollen die Blutbildung im Knochenmark bremsen. Sie wirken ähnlich wie eine milde Chemotherapie. In sehr seltenen Fällen kann eine Stammzellentransplantation erwogen werden. Sie ist die einzige Heilungsmöglichkeit, aber mit hohen Risiken verbunden. Deshalb bleibt sie meist eine Ausnahme. Entscheidend ist eine individuell angepasste Therapie und eine engmaschige ärztliche Betreuung. So kann die Lebensqualität erhalten bleiben und das Risiko für schwerwiegende Folgen wird deutlich reduziert.
Fazit
Polycythaemia vera ist eine seltene, aber ernstzunehmende Bluterkrankung. Unklare Beschwerden wie Kopfschmerzen, Juckreiz oder Schwindel sollten ärztlich abgeklärt werden. Dank moderner Diagnose- und Therapiemethoden lassen sich heute viele Komplikationen verhindern. Wichtig ist, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen und konsequent zu behandeln. Wer regelmäßig ärztliche Kontrollen wahrnimmt, hat gute Chancen auf ein stabiles Leben mit der Erkrankung.